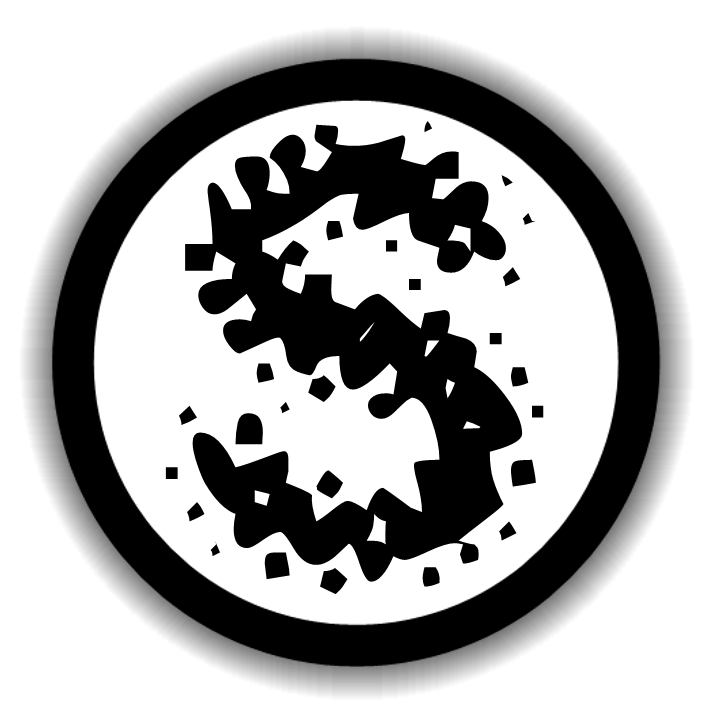Die Schule ist ein Spiegel der Gesellschaft – und wie sich diese verändert, so muss sich auch der schulische Bildungsauftrag anpassen. In einer Zeit, in der Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und eine zunehmende religiöse Pluralität den Bildungsalltag prägen, steht der Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen. Die Frage ist nicht, ob Religion in der Schule der Zukunft noch eine Rolle spielen sollte, sondern wie sie gestaltet werden muss, um den Anforderungen einer sich wandelnden Welt gerecht zu werden. Neben der Vermittlung religiöser Inhalte steht die kritische Reflexion über den eigenen Glauben und den anderer im Vordergrund. Die Herausforderungen, die sich aus der Digitalisierung ergeben, betreffen nicht nur den Religionsunterricht, sondern das gesamte Schulsystem. Datenschutz, Verzerrungen in KI-generierten Inhalten, veränderte Bewertungsmethoden und die Gefahr einer digitalen Spaltung sind zentrale Aspekte, die insbesondere im Kontext religiöser Bildung einer kritischen Betrachtung bedürfen.
Datenschutz und religiöse Identität in der digitalen Schule
Mit der zunehmenden Digitalisierung stellt sich die Frage, wie religiöse Überzeugungen und persönliche Glaubensfragen in einem digitalen Umfeld geschützt werden können. In einer Schulwelt, in der KI-gestützte Lernplattformen, Cloud-Dienste und digitale Tools immer häufiger genutzt werden, wird Religion zu einer besonders sensiblen Kategorie persönlicher Daten. Wie kann verhindert werden, dass die religiöse Identität eines Schülers oder einer Schülerin ungewollt in großen Datenpools gespeichert oder gar kommerziell genutzt wird? Lehrkräfte müssen sich bewusst sein, dass die Formulierung von Aufgaben und Fragen in KI-gestützten Systemen bereits eine Offenlegung sensibler Informationen bedeuten kann. So könnte ein Lernmanagementsystem, das KI-gestützte individuelle Lernwege anbietet, aus Antworten und Verhaltensweisen religiöse Zugehörigkeiten ableiten und speichern.
Besonders problematisch wird dies bei Schülerinnen und Schülern, die in einem familiären oder gesellschaftlichen Umfeld leben, in dem religiöse Fragen heikel sind. Ein Beispiel wäre eine muslimische Schülerin, die aus Angst vor Diskriminierung ihre religiöse Identität nicht öffentlich preisgeben möchte. Wenn jedoch KI-gestützte Analysen von Antwortverhalten oder Suchanfragen Rückschlüsse auf die religiöse Zugehörigkeit zulassen, kann dies zu ungewollten Offenlegungen führen. Hier braucht es klare datenschutzrechtliche Regelungen und eine Sensibilisierung der Lehrkräfte im Umgang mit solchen Systemen.
Verzerrungen und Extrempositionen in KI-generierten religiösen Inhalten
Ein zentrales Problem Künstlicher Intelligenz ist die Art und Weise, wie sie trainiert wird. KI-Systeme lernen aus riesigen Mengen an Daten, die aus unterschiedlichsten Quellen stammen. Gerade im Bereich Religion ist dies problematisch, da das Internet nicht nur offizielle Lehrmeinungen religiöser Gemeinschaften enthält, sondern auch extreme, fundamentalistische und pseudowissenschaftliche Ansichten. Ein KI-gestütztes System, das Fragen zum Christentum beantwortet, könnte beispielsweise auf Inhalte von Kreationisten oder den Zeugen Jehovas zurückgreifen, die in vielen Punkten nicht mit der theologischen Lehrmeinung der großen Kirchen in Mitteleuropa übereinstimmen. Dies kann dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler auf KI-generierte Antworten stoßen, die wissenschaftlich nicht haltbar sind oder nicht dem aktuellen Stand der theologischen Forschung entsprechen.
Ein konkretes Beispiel: Ein Schüler fragt eine KI nach der Entstehung der Welt aus christlicher Sicht. Die KI könnte – je nach Trainingsdaten – antworten, dass die Erde vor 6000 Jahren erschaffen wurde, weil diese Sichtweise von Kreationisten vertreten wird. Solche Antworten können in einem Religionsunterricht, der sich um theologische Reflexion und wissenschaftliche Einordnung bemüht, problematisch sein. Ebenso könnten KI-Systeme Aussagen der Zeugen Jehovas als allgemeine christliche Lehrmeinung präsentieren, obwohl diese theologisch stark von anderen christlichen Strömungen abweichen.
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, Schülerinnen und Schüler für diese Problematik zu sensibilisieren. Lehrkräfte im Religionsunterricht der Zukunft müssen eine Kernkompetenz vermitteln: die kritische Beurteilung von KI-generierten Inhalten. Dies bedeutet nicht nur das Erkennen von Verzerrungen und Fehlern, sondern auch das Hinterfragen von Quellen, das Vergleichen mit etablierten theologischen Standpunkten und das Entwickeln eines reflektierten Umgangs mit digitalen Informationen.
Bewertungsmaßstäbe im Religionsunterricht der Zukunft
Die Art, wie Wissen in der Schule überprüft wird, verändert sich durch KI radikal. Während schriftliche Hausarbeiten und klassische Prüfungsformate leicht durch KI-generierte Texte ersetzt werden können, erfordert der Religionsunterricht eine Neubewertung von Leistungsnachweisen. In Zukunft werden eher dialogische Prüfungsformate an Bedeutung gewinnen, in denen es nicht nur um das Reproduzieren von Wissen geht, sondern um die Fähigkeit zur Reflexion, Argumentation und ethischen Urteilsbildung.
Ein denkbares Prüfungsformat könnte beispielsweise eine mündliche Debatte zu einer religiösen Fragestellung sein: Wie lässt sich Glaube mit Naturwissenschaft vereinbaren? Welche Rolle spielt Religion in einer säkularisierten Gesellschaft? Solche Prüfungen würden die Fähigkeit fördern, sich mit unterschiedlichen Positionen auseinanderzusetzen und eine eigene reflektierte Meinung zu entwickeln.
Zudem sollte der Religionsunterricht stärker auf interaktive und interdisziplinäre Methoden setzen. Ethik, Philosophie und Sozialwissenschaften könnten stärker eingebunden werden, um eine umfassende Bildung zu ermöglichen, die über das reine Lernen von Glaubensinhalten hinausgeht. Dabei sollte auch die religiöse Pluralität an beruflichen Schulen berücksichtigt werden. Gerade in diesen Schulformen treffen junge Menschen aus unterschiedlichsten kulturellen und religiösen Hintergründen aufeinander. Der Religionsunterricht der Zukunft muss daher verstärkt interreligiös arbeiten und den Dialog zwischen verschiedenen Glaubensrichtungen fördern.
Digitale Kluft und religiöse Pluralität in beruflichen Schulen
Ein weiteres Problem der digitalen Transformation ist die Ungleichheit beim Zugang zu digitalen Ressourcen. In bildungsfernen Haushalten oder solchen mit geringem technischem Know-how haben viele Schülerinnen und Schüler nicht die gleichen Möglichkeiten, KI-gestützte Lernwerkzeuge zu nutzen. Dies betrifft insbesondere auch den Religionsunterricht: Während einige Schüler:innen digitale Bibeln, Koran-Apps oder KI-gestützte theologische Enzyklopädien nutzen können, haben andere gar keinen Zugang zu diesen Ressourcen oder wissen nicht, wie sie sie sinnvoll einsetzen können.
Zudem erleben gerade berufliche Schulen eine besonders starke religiöse Pluralität. Viele Schüler:innen haben einen Migrationshintergrund und bringen unterschiedliche religiöse Prägungen mit. Der Religionsunterricht muss daher Wege finden, diese Vielfalt konstruktiv zu nutzen und nicht durch digitale Ungleichheiten noch weiter zu verstärken. Dies kann beispielsweise durch gemeinsame digitale Projekte geschehen, in denen Schüler:innen aus unterschiedlichen religiösen Hintergründen miteinander arbeiten und voneinander lernen.
Fazit: Religion als Reflexionsraum in der digitalen Schule
Der Religionsunterricht der Zukunft wird nicht überflüssig, sondern wichtiger denn je. In einer Welt, in der KI immer mehr Wissen produziert, bleibt die Fähigkeit zur Reflexion, zur kritischen Einordnung und zum interreligiösen Dialog eine zentrale Kompetenz. Datenschutz, die Bewertung von KI-generierten Inhalten, neue Prüfungsformate und die Vermeidung digitaler Ungleichheiten sind Herausforderungen, die den Religionsunterricht tiefgreifend verändern werden. Die Schule der Zukunft darf Religion nicht als veraltetes Konzept betrachten, sondern muss sie als zentralen Bestandteil der kulturellen und ethischen Bildung in einer pluralistischen Gesellschaft weiterentwickeln.
Dieser Artikel ist mit Unterstützung von textgenerativer künstlicher Intelligenz entstanden im Rahmen meiner persönlichen Vorbereitungen in den vergangenen Tagen auf den Fachtag „Religion in der Schule der Zukunft“ am 05.04.2025 in Stuttgart. Die zugrunde liegenden Aspekte/Inhalte wurden von mir vorgegeben, die Formulierungen teilweise redigiert, die Arbeit am Text durch KI jedoch deutlich erleichtert.